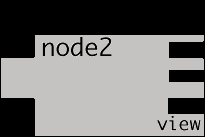
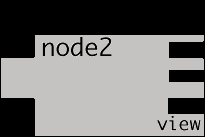 |
|
node2: view
THEMA Einblicke und Ausblicke
In der ersten Übung haben Sie eine Wegbeschreibung und einen Plan Ihrer Wohnung verbunden. Man kann diese beiden Nodes als Abfolge eines Aussenraums und eines darauf folgenden Innenraums verstehen. Allerdings sind sowohl der Text als auch der Plan sehr abstrakte, formalisierte Darstellungsarten, die nicht unbedingt geeignet sind, diesen Gegensatz von Innen und Aussen zu vermitteln. Bei der Parallelprojektion (um die es sich bei der Plandarstellung handelt) nimmt der Betrachter einen unendlich entfernten Standpunkt ein. Er ist ausserhalb des dargestellten Raums, betrachtet ihn mit objektiver Distanz. In dieser zweiten Übung geht es um Einblicke und Ausblicke. Der Gegensatz zwischen innen und aussen wird also viel stärker betont. Die Perspektivprojektion weist, im Gegensatz zur Parallelprojektion, dem Betrachter einen präzisen Standpunkt zu. Dadurch entsteht eine direkte Beziehung zwischen Subjekt und Objekt. Perspektivische Darstellungen können deshalb immersiv wirken, sie geben dem Betrachter das Gefühl, Teil der Szene zu sein. Dadurch sind sie auch weniger analytisch als die Parallelprojektionsdarstellungen. Der Wahl des Blickpunkts innerhalb einer Szene stellt eine subjektive Wertung dar. Eine der interessanten Eigenschaften, die ein Computermodellierprogramm bietet, ist die Möglichkeit, gleichzeitig in mehreren Projektionsarten zu arbeiten. Somit ist es beispielsweise möglich, an einer Axonometrie und/oder einer Plandarstellung zu arbeiten, während in einem anderen Teil des Bildschirms eine Perspektive dargestellt ist. Mit anderen Worten: der Computer ermöglicht das gleichzeitige Arbeiten sowohl in objektiv-analytischen, als auch in subjektiv-immersiven architektonischen Repräsentationsformen desselben Modells. Das Generieren von perspektivischen Ansichten durch die interaktive Manipulation eines Computermodells erinnert sehr stark an die Arbeit eines Photographen, der ein wirkliches Gebäude photographiert. Genau wie in der Photographie ist es notwendig, den Raum genau zu studieren, um die treffende Bildkomposition zu finden. Das Computerprogramm erlaubt auch die Manipulation der Perspektivparameter, was etwa dem Gebrauch verschiedener Objektive beim Photographieren entspricht. Die Frage nach der Bildwahrheit, also die Frage, wo die Grenzen zwischen Erscheinung und Wirklichkeit verlaufen, stellt sich in der Photographie ebenso wie bei der Computer-generierten Darstellung.
AUFGABE
In dieser Übung erstellen Sie, aufbauend auf dem Plan der letzten Übung, ein dreidimensionales Modell Ihrer Wohnung. Als Vorbereitung sollten Sie das zweite und das dritte MicroStation Tutorial (Triforma) gemacht haben. Für die Gestaltung Ihres Nodes geht es um die Auseinandersetzung mit der perspektivischen Darstellung, die mit dem dreidimensionalen Modell möglich ist. Wie detailliert Sie Ihre Wohnung nachmodellieren, bleibt Ihnen überlassen. Wir empfehlen allerdings Zurückhaltung: ein Architekturmodell, nicht eine Puppenstube sollte die Zielsetzung sein. Daneben können Sie aber auch Photographien von Ihrer Wohnung zur Gestaltung Ihrer Nodes verwenden.
|

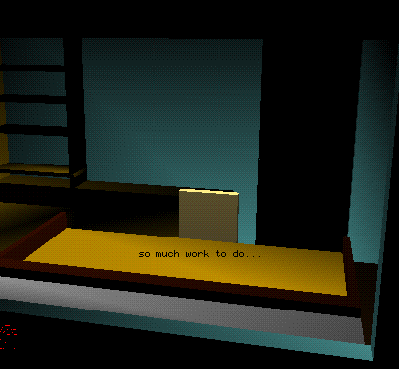
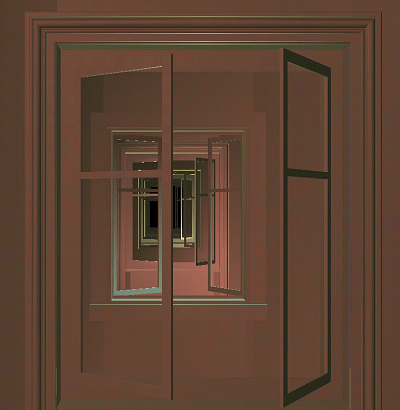
Fig. 2.1. Übung von Nilufar Kahnemouyi, Sommersemester 1997.
|
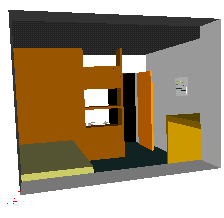 |
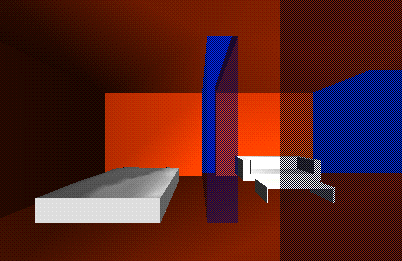 |
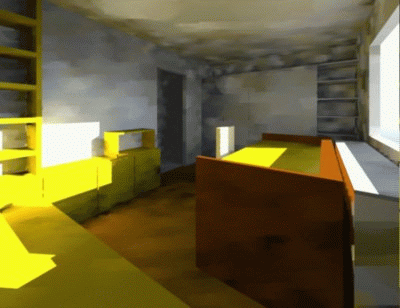 |
| Fig. 2.4. Übung von Wei Wu, Sommersemester 1997. | Fig. 2.5. Übung von Lorenz Schmid, Sommersemester 1997. | Fig. 2.6. Übung von Peter Sturzenegger, Sommersemester 1997. |
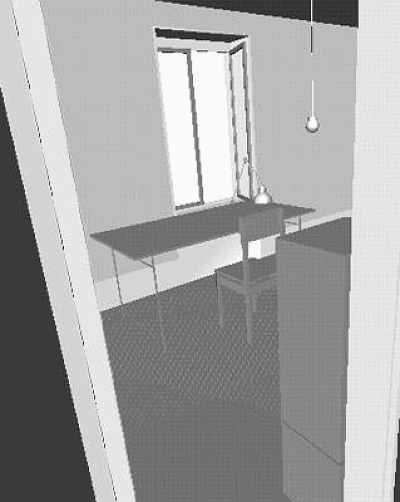 |
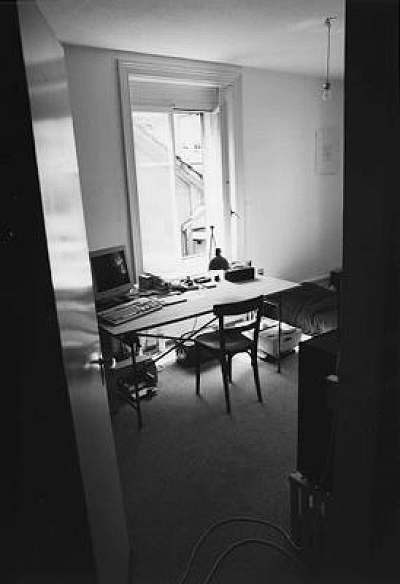 |
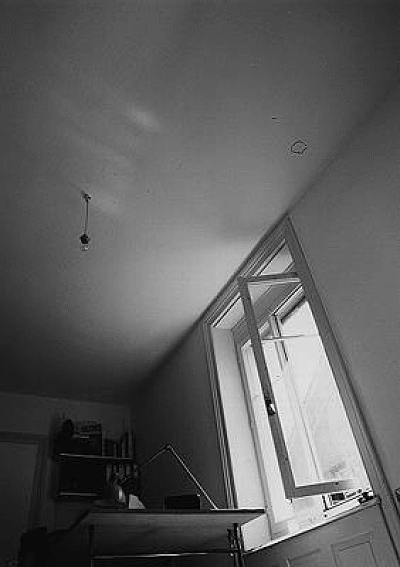 |
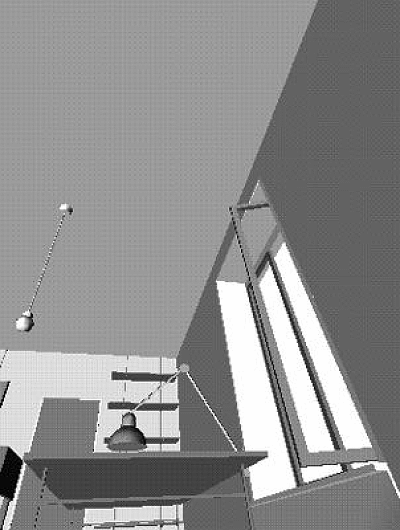 |
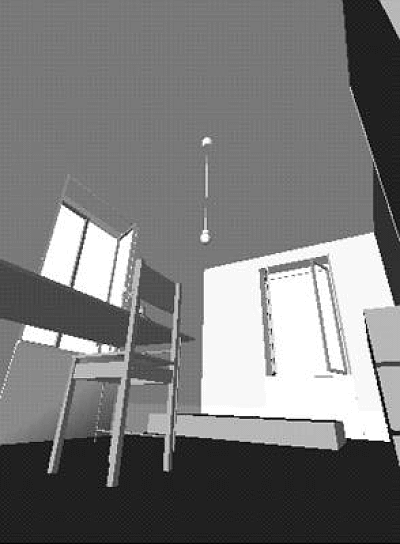 |
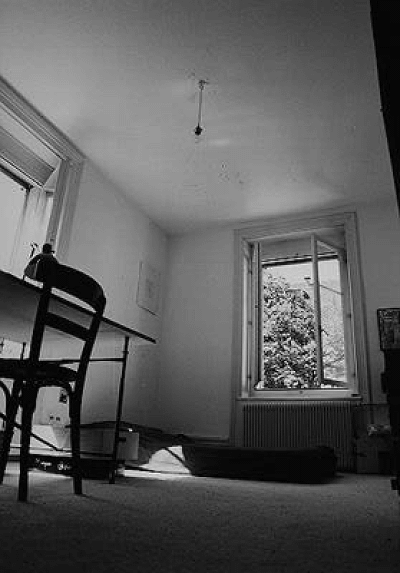 |
|
| Fig. 2.7 - 2.12. Übung von Markus Horn, Sommersemester 1997. | ||||||
|
Wiederum sollten Sie Ihre Nodes im Hinblick auf einen bestimmten Kontext in fake.space entwickeln, auf den Sie inhaltlich Bezug nehmen. Dabei kann es sich um Ihre eigenen Nodes aus der letzten Übung handeln. Interessanter ist es allerdings, wenn Sie sich in einen anderen Erzählstrang einklinken, wenn Sie Themen von anderen fake.space Autoren aufgreifen und weiterspinnen. Je deutlicher Sie den Bezug zu diesen anderen Nodes machen, desto stärker und inspirierender für andere kann dieser Erzählstrang werden.
ABGABE
Detaillierte Angaben zur Abgabe können Sie der Kurshomepage entnehmen.
|
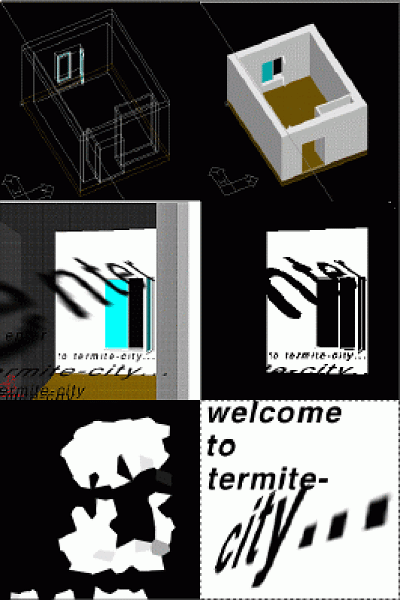 Fig. 2.13. Übung von Caroline Brunner, Sommersemester 1997.
|

Fig. 2.14. Übung von Stephan Vettiger, Sommersemester 1997. |
This website has been archived and is no longer maintained.